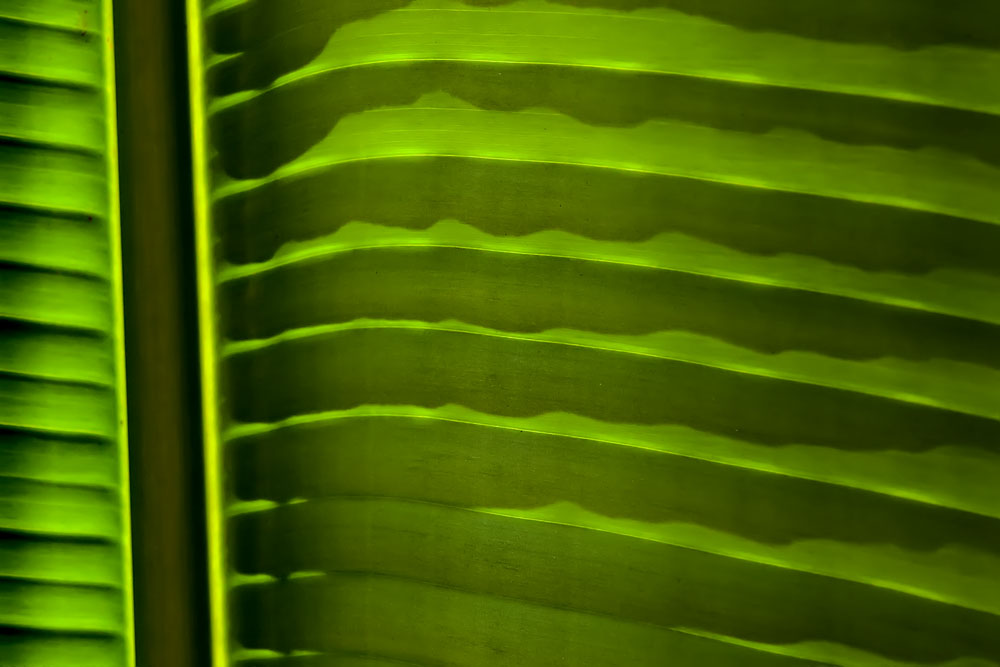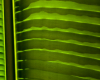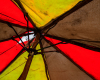Ein zerplatzter Traum
Auf Madagaskar sagt man: „Jeder Weg trifft irgendwo einen anderen Weg“. Mein Weg der Annäherung an die viertgrößte Insel der Welt war lang und hat fast 10 Jahre gedauert. Es sollte eine „photographische Traumreise“ werden. Das sie „fast“ zu einem Alptraum geworden ist liegt nicht an Madagaskar oder den Menschen dort; – nein, es liegt an mir. Für Reisen vor unserer erweiterten Haustür, und dazu darf man heutzutage auch viele Länder Afrikas und Asiens zählen, bedarf es keiner großen Vorbereitung. Für Zentralafrika und „Randafrika“ – und dazu muss man Madagaskar zählen -, sollte man gut vorbereitet sein. Für Individualreisende oder reisende Fotografen nicht immer ganz einfach.
Bereits im Mai 2010 begannen die Gespräche mit dem Veranstalter, der über eine langjährige Erfahrung im Lande und entsprechende Kontakte verfügte. Wenn nun mein Traum zerplatzt ist liegt es einzig und allein daran, dass Erwartung und Realität kollidierten. Es lag daran, dass die Organisatoren kleine aber wichtige Details unerwähnt ließen, wie zum Beispiel die Zahl der Expeditionsteilnehmer, die Art der Fortbewegungsmittel, auch die sich eventuell daraus ergebenden Probleme vor Ort. Wie Dimby, unser madegassischer Reisebegleiter, es ausdrückte: „Madagascar is the country of mura-mura !“ Was so viel heißt wie: „Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. „
Aber das ist oft leichter gesagt als getan. Trotz alle dem: – Begleiten Sie mich bei einem Streifzug durch die madegassische Wirklichkeit !
Take me back to my boat on the river ?
Ein Titel der Popgruppe Styx aus den 70ern ! Styx; – war da nicht etwas ? Den Styx der griechischen Mythologie beschreibt Homer als „Wasser des Grauens“. Der Sage nach stellt der Fluss die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich dar. Ein bisschen etwas davon hat auch die Bootsfahrt auf dem Tsiribihina. In Miandrivazo erreichen wir den großen Fluss. Es regnet. Ungewöhnlich für diese Region und Jahreszeit. Die dringende Empfehlung zum Kauf eines „Schattenspenders“, wasserdichter Müllsäcke und ausreichend Trinkwasser hätte mir zu denken geben sollen. Als am nächsten Morgen die Sonne wieder scheint, wird das Gepäck in die Pirogen verladen. Der Seesack kommt als Rückenlehne senkrecht ins Kreuz, die schwere Kameraausrüstung findet auch ihren Platz. Ganz wichtig! – das Sitzkissen unter dem Allerwertesten platziert und die Wasserflasche griffbereit. Und schon geht es los.
In den ersten Stunden gleitet die Piroge sanft auf dem Strom dahin. Am Ufer waschen Frauen Wäsche, Hirten führen ihre Zebu-Herde zur Tränke, und Kinder vergnügen sich beim Baden. Dann beginnt die Landschaft monotoner zu werden. Gegen Mittag türmen sich am Horizont hohe Cumulus-Wolken auf. Eine drückende Schwüle lastet auf dem Fluss und die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. Man sieht das in der Ferne, Regenschauer niedergehen, und man hegt mit jeder Flussbiegung die Hoffnung, dass man den Lagerplatz für die Nacht noch vor Sonnenuntergang erreichen wird und die schweren Regenwolken weiterziehen werden. Die Hoffnung ist vergebens! Plötzlich kommt Wind auf. Wasser schwappt über das Dollbord; dicke Regentropfen prasseln vom Himmel herab und innerhalb weniger Minuten bricht die Hölle los. Die Boote laufen voll. Schnell wird ein Platz für eine Notanlandung gesucht; – nichts wie ans rettende Ufer! Wir stehen zusammengedrängt auf einer Landspitze. Die Fluten, die der Himmel schickt, sind kälter als das Wasser des Flusses. Und bald schon beginne ich mit den Zähnen zu klappern, so kalt ist mir. Jede Faser, die ich am Leib trage, ist durchnässt. – Geld, Ausweispapiere, Kameraausrüstung – alles nass! Nach über einer Stunde lässt das Inferno nach. Es regnet „weniger heftig“. Die Boote werden so – gut es geht – leer geschöpft, denn es muss weiter gehen. Nach einer Weile erreichen wir eine Sandbank, welche ausreichend Platz für die Zelte bietet. Das Erlebnis hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Die Bootsfahrt währt noch drei Tage und ich denke nur: Hoffentlich geht es endlich vorüber! Mir gehen die Erlebnisse früher Entdecker durch den Sinn. Der schottische Arzt Mungo Park reiste mit seinen Gefährten auf dem Niger und nahm unendliche Strapazen auf sich. Er hatte ein Ziel. Er wollte den Lauf des Nigers erkunden; er suchte nach Ruhm für Gott, König und Vaterland. Meine Pläne waren nicht so hochfliegend. Ich wollte schöne Fotos machen. Dies gelingt aus der „Pirogen-Perspektive“ jedoch nicht.
Bin ich die „Huber-Buam“ ?
Sicherlich nicht ! Ich bin des Deutschen zumindest soweit mächtig, dass ich Einzahl und Mehrzahl nicht verwechsele. In den Tsingy-de-Bemahara bedarf es unbedingter Trittsicherheit. Im madegassischen bedeutet Tsingy soviel wie Nadel. Bei Belopaka beginnt das Gebiet, das rund 1.500 km² bedeckt. Es ist ein urzeitliches ozeanisches Kalksteinplateau, welches nach dem zerbrechen des Ur-Kontinents Gondwana und dem zurückweichen der Meere wie eine Insel in die Urwaldlandschaft eingebettet ist. Die Elemente und tektonischen Bewegungen sorgten für bizarre Strukturen.
Am ersten Tag „steigen“ wir in die kleinen Tsingys ein. Auf dem schmalen Urwaldpfad begleitet uns ein ortskundiger Führer. Das Blätterdach ist dicht, am Boden kommt nur diffuses Licht an. Die Temperatur steigt und es kommt echtes Dschungel-Feeling auf. Die Durchlässe zwischen den Felsen sind so eng, dass man hindurch kriechen, den Rucksack absetzen und hinter sich her ziehen muss. Immer wieder kommt unsere Kolonne zum Stehen. Irgendjemand „vorne“ hat etwas entdeckt, was es zu fotografieren gilt. Was ? Keine Ahnung ? Es bewahrheitet sich der Spruch meines hessischen Landsmannes Bodo Bach: „Stau ist blöd wenn man hinten ist; – vorne geht’s“. Es geht aufwärts. Die Kalksteinnadeln sind messerscharf. Man hat Tritte in den Fels gesetzt, vereinzelt Leitern hineingestellt und Drahtseile gespannt. Die Huber’s lassen grüßen! An einigen Aussichtspunkten sind hölzerne Plattformen eingelassen, und man hat einen grandiosen Ausblick auf den „Nadelwald“. Halsbrecherischen Abstiegen folgen immer wieder gewagte Kletterpassagen. Es geht auf und ab. Nach knapp 6 Stunden erreichen wir wieder den Ausgangspunkt am Parkeingang. Für den kommenden Tag ist eine Exkursion in die „großen Tsingys“ geplant. Spektakulärer noch als der erste Kletterparcours. Ich wäge für mich die Risiken und den (photographischen) Nutzen ab und beschließe die großen Tsingys den Huber-Buam zu überlassen.
Rush hour auf der Baobab-Allee
Von Belopaka aus muss man die ganze Strecke bis nach Belo-sur-Tsiribinhia zurück. Auf der Hinfahrt hatten wir hier Mittagsrast gemacht und in einem Restaurant mehr als 4 Stunden auf ein paar einfache Käse-Sandwiches gewartet. Dass wir hier wieder anhalten, treibt mir Schweissperlen auf die Stirn. Nicht etwas deswegen, weil es draußen wieder glühend heiß ist, sondern weil wir mit der Fähre noch über den großen Fluss müssen und von dort noch eine lange Fahrt bis zur „Route des Baobabs“ haben.
Leider hat sich am Service des Restaurants in den vergangenen zwei Tagen nichts gebessert. Mura-Mura – Nur die Ruhe nicht verlieren! Als die Schatten immer länger werden , rutsche ich nervös auf dem Autositz hin und her. Jeder will die Baobab-Allee bei Sonnenuntergang fotografieren. Es ist eines der Traumbilder, die sich in meiner Erinnerung festgebrannt haben. Beim letzten Tageslicht „rollen“ wir auf die Allee. Es ist wie so oft, wenn man sich etwas ganz fest wünscht: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Einige Touristen bevölkern bereits die Gegend rund um die gigantischen Baumriesen. Kleinhändler haben ihre Stände aufgebaut und verkaufen „Geschnitztes“… und doch – letztendlich nimmt mich der Zauber der untergehenden Sonne, die hinter den knorrigen Riesen versinkt, – gefangen. 4000 Jahre sollen die Bäume alt werden können. Was haben sie nicht schon alles gesehen! Welche Torheiten der Menschen haben sie schweigend erduldet. Sie werden hoffentlich noch immer da sein, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt. Als ich mich noch einmal in Richtung der großen Bäume umdrehe, fällt mir ein Satz von Khalil Gibran ein, der mir passend erscheint:
„Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. Wir fällen sie und verwandeln sie in Papier, um unsere Leere darauf auszudrücken“.
Ich bin der König im Affenwald !
Die Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars ist einzigartig. Obwohl die Insel nur 400 km östlich des afrikanischen Festlandes im Golf von Mocambique liegt, haben sich hier Arten erhalten oder im Laufe der Evolution entwickelt, die man sonst nirgends auf unserem Planeten findet. Madagaskar war einst Bestandteil des Urkontinentes Gondwana; einer Landmasse aus Südamerika, der Antarktis, Afrika, Indien und Australien. Vor 250 Millionen Jahren begann Gondwana zu zerfallen. Bereits recht früh; im Erdmittelalter, trennte sich Madagaskar von der Afrikanischen Platte und bildete so etwas wie einen Mikrokontinent.
Wer etwas von der Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars sehen und erleben will, der sollte die Regionen im Berg-Regenwald von Andasibe und im Tiefland-Regenwald am Canal-des-Pangalanes besuchen. Im Gegensatz zum afrikanischen Festland, finden sich auf Madagaskar keine wirklichen „Giftschleudern“ und auch keine Raubtiere, die dem Menschen gefährlich werden könnten. Zu den faszinierendsten Tieren im Regenwald zählen sicher die Chamäleons. Rund 60 endemische Arten findet man auf Madagaskar. Chamäleon kommt aus dem griechischen und heißt übersetzt „Erdlöwe“; aber es sind eher kleine, harmlose Drachen. Die Überlebenskünstler haben sich an alle klimatischen Bedingungen angepasst. Einem Nurejew gleich, balancieren die Echsen auf einem Ast. Das linke Bein vor und wieder zurück; – als folgten sie einer ausgeklügelten Choreographie. Alles was sich um sie herum bewegt, sei es Freund oder Feind, haben sie fest im Blick. Die Augen erfassen wie bei einem Radar einen Blickwinkel von 342°. Nur was hinter ihrem Rücken vor sich geht, bleibt ihnen verborgen. Aber wen kratzt das schon! Im Bruchteil einer Sekunde schnellt ihre klebrige Schleuderzunge vor, sie kann bis zum 1.1/2 fachen der Größe des ganzen Tieres betragen, und saugt Stabschrecken und ähnliche Insekten, die auf ihrem Speiseplan stehen, in den Rachen. Eine Wesensart, die sie mit uns Menschen gemein haben?: Chamäleons können ihren Gemütszustand über die Haut anzeigen. Ärgern wir uns, oder werden wir bei einer Unwahrheit ertappt, laufen wir häufig rot an. Bei Chamäleons ist das genauso. Treffen sie auf einen Rivalen, so verleihen sie ihrem Missfallen Ausdruck, indem sie die Hautfarbe wechseln und eine Alarmfarbe annehmen. Werden sie nächtens in ihrem Schönheitsschlaf gestört, nimmt die Haut eine schwarze Farbe an. Man weiß nicht so genau ob sie sich tarnen oder „schwarz ärgern“.
Frühmorgens breche ich mit Olivier auf. Olivier ist Biologe und arbeitet in der Reserve de Perinét. Ich nenne Olivier den Maki-Flüsterer.
Wer nach Madagaskar reist, der will Lemuren sehen. Diese Halbaffen sind so etwas wie die „guten Geister des Waldes“; und wir geraten geradezu in Verzückung, wenn wir den pelzigen Kletterkünstlern begegnen. Bei aller Zutraulichkeit sollten wir jedoch nicht vergessen, dass wir uns nicht in einem Streichelzoo befinden, sondern dass die vorwitzigen Kronen- und Mohren-Makis, die uns zur Belustigung auch schon mal auf die Schulter oder den Fotorucksack springen, wilde Tiere sind, die ihre Blätterdiät gerne einmal um ein Stück Banane bereichern. Jeder ist eben bestechlich! Sind die Bananen alle, sind sie schnell wieder im Unterholz verschwunden.
Ein Streifzug durch den Regenwald ist spannend und abwechslungsreich. Am Wegesrand finden sich allenthalben blühende Orchideen oder verhutzelte Schoten, für die Madagaskar weltberühmt ist; wir kennen sie als Vanille, die ebenfalls zu den Orchideen-Gewächsen gehört. Leuchtend rote Pilze bewuchern verrottende Baumstämme. Plötzlich vernehmen wir aus der Ferne das langgezogene „uuuuiiihhhjep“ ! – Der Schrei eines schwarzen Indri. Wir pirschen uns langsam heran und warten fast eine Stunde bis sich „Herr Indri“ an unsere Anwesenheit gewöhnt hat, und sich durch eine Banane vom Baum locken lässt. Genüsslich kaut er auf allen Backen. Tiere in freier Wildbahn zu fotografieren gehört zur hohen Schule der Fotografie. Ein Art Wolfe, ein Frans Lanting oder ein Norbert Rosing geniessen meine allergrößte Bewunderung! Heute bin ich selbst einmal ein „kleiner Lanting“ und freue mich über jedes gelungene Foto. Der Indri strahlt mit seinen leuchtend gelben Augen ins Objektiv meiner Kamera; – und der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich sehe Cockerill-Sifakas, Mohren- und Kronen-Makis und Varis, die sich vor meiner Hütte in einer Astgabel auf die faule Haut gelegt haben. Das mache ich auch,- und bin zum ersten Mal auf der gesamten Reise rundherum glücklich.
Reif für die Insel ?
Warum haben wir Europäer einen solchen Hang zu Trauminseln ? Sylt, Mallorca, Ibiza, die Malediven, Hawaii oder Bora-Bora. Ich kann es nicht erklären und vermag es auch nicht zu teilen. Liegt es vielleicht daran, dass wir uns in unserer übervölkerten Welt immer weniger zurechtfinden und die Sehnsucht haben an einem weißen palmengesäumten Sandstrand, am blauen Meer entlang, dem Sonnenuntergang entgegen zu gehen? Ich habe diese Sehnsucht nicht, empfinde ein „Paradies“ immer auch ein wenig als Gefängnis der Langeweile. Vielleicht bin ich im Hebbel’schen Sinne zu sehr Realist, denn Hebbel meinte:
Der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange.
Trauminsel und Endpunkt unserer Madagaskar-Reise ist die Ile-des-Nattes. Träume haben ihren Preis; – und so ist die Anreise auch nicht ganz einfach. Nachdem wir uns auf dem Gewürzmarkt von Tamatave noch mit Vanille, Zimt und Pfeffer eingedeckt haben, mit denen wir die Daheimgebliebenen zu beglücken gedenken, geht es los. Bis zum „Fährhafen“ ist es noch eine ganze Ecke zu fahren und heute ist Allerheiligen, auf Madagaskar ein gesetzlicher Feiertag. Die Formalitäten für unsere Schiffsreise sind „afrikanisch einfach !“: Da werden die Pässe einmal bei der Gendarmerie und einmal bei der Hafenbehörde feinsäuberlich von Hand abgeschrieben. Der im Gewittersturm auf dem Tsiribihina aus dem Pass gewaschene Visastempel wird zum Hindernis; – und nach gut 2 Stunden kann es endlich losgehen. Eine Fähre auf Madagaskar, das ist ein Boot, 2 Außenborder dran, hoffnungslos überladen schon mit dem Gepäck der Touristen, dazu kommen noch lebende Hühner, bündelweise Lauch – und die dazugehörigen Madegassen. Die Fahrt führt gut 2 Stunden über den Indischen Ozean auf die Ile Sainte-Marie. Lonely Planet beschreibt die Gewässer als „hai-verseucht“. Think positive ! Wenn wir kentern, können wir zuerst die Hühner opfern ! Zweieinhalb Stunden später sind wir auf Saint Marie ohne die Dreiecksflosse eines Hais gesehen zu haben. Dafür geht der Hindernislauf mit Gepäck in die nächste Runde. Das ganze Gepäck wird auf die Dächer zweier Kleinbusse geladen; 20 Minuten durch den großen Garten Eden in Richtung des kleinen Garten Eden. Die Ile-des-Nattes ist eigentlich ein Wurmfortsatz der Ile Sainte-Marie. Vor einigen Jahren ist ein Tropensturm über die Südspitze der Insel gerast und hat Nosy Nato, wie die Insel auf malagasy heißt, von Sainte-Marie abgeschnitten. Also; – wieder in die Boote. In einem offenen Einbaum bringt mich ein madegassischer Rastafari auf die Insel. Nosy Nato ist nicht meine Trauminsel und schon gar kein Paradies. Autoverkehr gibt es nicht, die wenigen befestigten Wege befahren vor allem Kinder mit ihren Fahrrädern. Die Insel lebt von Fischfang und bescheidenem, saisonalem Tourismus. Die 8 Kilometer rund um die Insel bewältigt man in gut 3 Stunden. Ab und an ragen Palmen schlangenförmig in Richtung Meer, wie der Finger einer Hand, die nach dem Festland greift. Die Urgewalt des letzten Sturmes hat sie geformt; der nächste Sturm wird sie brechen und davon spülen. In den Tagen auf Nosy Nato finde ich Zeit über die Reise nachzudenken.
…wir hatten die Pest an Bord ?
Nein; – so war es nicht! Man darf nicht ungerecht sein. Madagaskar ist eine tolle Insel, mit fröhlichen Menschen, von denen die meisten einen täglichen Überlebenskampf führen, den wir uns nicht im Entferntesten vorstellen können. Was sind schon meine Befindlichkeiten im Vergleich dazu!
Reisen Sie nach Madagaskar, reisen sie in ganz kleinen Gruppen, nehmen Sie sich Zeit (und Geld) mit ! Denken sie daran, dass Mura-Mura ein Lebensgefühl ist, das nichts mit Flugplänen und Abfahrtszeiten, aber auch leider nichts mit Photographie zu tun hat. Die Worte des englischen Gelehrten Samuel Johnson scheinen mir am besten zu den Erfahrungen „meiner“ Madagaskar-Reise zu passen:
„Der Sinn des Reisens besteht darin, unsere Phantasien durch die Wirklichkeit zu korrigieren.
Statt uns die Welt vorzustellen, wie sie sein könnte, sehen wir sie wie sie ist.“
(Samuel Johnson)