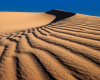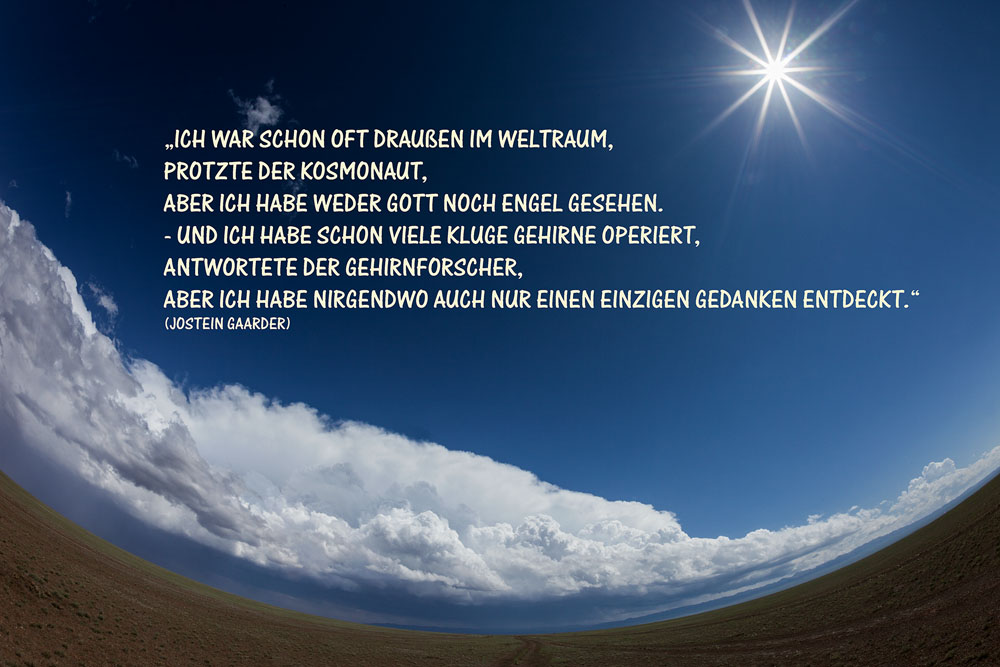Auf den Spuren von Dschingis Khans Erben
Es war eine langsame Annäherung an ein Land, das schon immer einen Reiz auf mich ausgeübt hat, den ich nicht zu erklären vermag. Ich war im Zwiespalt. Einerseits wollte ich die endlose Weite der Steppe sehen, andererseits ist für mich in einem fremden Land auch immer der Kontakt zu den Menschen wichtig, und die sind in der Mongolei spärlich gesät. Mit nur 1,9 Einwohnern pro Quadratkilometer, ist es das am dünnsten besiedelte Land der Erde. So habe ich die Reise immer wieder verschoben, weil es andere Ziele gab, die mir lohnender erschienen. Als mir eine Freundin ein kleines Büchlein von Fritz Mühlenweg schenkte, war der Entschluss schnell gefasst, und ich musste bald feststellen, wie wenig ich bisher über dieses ferne Land wusste.
Die Mongolei sieht aus wie ein Rohentwurf Gottes als er die Erde plante – nicht wie ein Land sondern eher wie eine Ansammlung von Zutaten, Gras, Gestein, Wasser und Wind. (Stanley Stewart)
Während Dschingis Khan’s Männer die fast 7000 km noch zu Pferde zurücklegen musste, reise ich relativ bequem in etwas über 8 Stunden, mit Zwischenlandung in Moskau in die Hauptstadt Ulaanbaatar.
Ulaanbaatar – aufstrebende Moderne in sozialistischem Grau
Am Flughafen empfangen mich Dojoodorj (zu schwierig für unsere Zunge ? – man spricht es wie Sosor aus !) und Alagh; die Beiden werden mich in den nächsten Wochen begleiten. Der Himmel über Ulaanbaatar ist grau und Regen verhangen in diesem Mai. Ich habe mich für die Vorsaison entschieden. Die Mongolei ist nur wenig touristisch erschlossen, und in der Hauptreisezeit tummeln sich die Besucher konzentriert an den landschaftlichen Höhepunkten des Landes. Dem will ich aus dem Wege gehen. Sosor – ganz Reiseleiter – schildert auf den wenigen Kilometern zwischen Flughafen und Hotel schon den Verlauf der ganzen Reise. Ich muss ihn gleich am Anfang bremsen. Das Hotel Bajangol in der Stadtmitte gehört zu den ersten Adressen der Hauptstadt, hat aber schon bessere Tage gesehen. Die Scheiben etwas blind, die Farbe splittert vom Fensterrahmen ab, und das Interieur des Hotelzimmers stammt aus sozialistischen Tagen. Bis hierher ist der Fortschritt noch nicht gekommen. Ulaanbaatar beherbergt knapp 1 Million Mongolen, und das sind fast 40% der Gesamteinwohnerzahl der Mongolei. Dass eine solche Konzentration für die Stadtentwicklung ihre Probleme bringt, ist augenfällig. Zwischen heruntergekommenen Plattenbauten findet man schmucke Holzhäuser, aber auch die traditionellen Ger.
Nach einer kurzen Siesta, brechen wir – noch Jetlag-geplagt – zu einer kleinen Stadtrundfahrt auf. Die Gemütslage passt sich dem Wolkenhimmel an „grau“. Die Stadt ist nicht aufregend und wirkt irgendwie zersiedelt. Vom Ehrenmal für die russischen Soldaten, das sich auf einem Hügel über der Stadt erhebt, hat man einen Panoramablick. Ulaanbaatar heißt übersetzt „roter Held“, und folgerichtig steht am Fuße des Hügels auf einem Sockel ein T 34 Panzer, mit dem mongolische Einheiten als Alliierte der Roten Armee im Mai 1945 in Berlin ankamen. Die Sammlungen des Nationalmuseums oder Naturkundemuseums sind für verwöhnte Mitteleuropäer nur von mäßigem Interesse, auch wenn Sosor meint es gäbe dort „saure Eier“. Nach mehrfacher Nachfrage bekomme ich heraus, dass er Saurier-Eier meint. Sie werden fragen, warum nörgelt der Kerl die ganze Zeit herum. Er muss ja nicht hinfahren, wenn es ihm dort nicht gefällt. Vielleicht deswegen, weil Ulaanbaatar Bemerkenswertes bietet, wo man es am wenigsten erwartet.
Dazu gehört das Kloster Gandantegtschinien, dessen Gründung auf die fünfte Inkarnation des Bogd Gegeen zurückgeht, also ein buddhistisches Kloster ist. Falls Ihnen jetzt ein Fragezeichen auf der Stirn steht; – ich hatte vom Bogd Gegeen auch noch nie etwas gehört und erst viel später auf meiner Reise durch die Mongolei gelernt, dass er nach dem Dalai Lama und dem Pantschen Lama der dritthöchste Würdenträger in der Hierarchie des Lamaismus ist. Nach Ende der kommunistischen Herrschaft im Jahr 1990, haben die Klöster wieder regen Zulauf. Gandan ist das größte aktive Kloster in der Mongolei. Schier erschlagen wird man von der Statue des Megdshid Dshanrajsig, die in einem etwas abseits gelegenen Tempel steht. 26,5 m ist der Koloss hoch, 60 to. schwer, mit 8,6 kg Gold überzogen und von 2100 Edelsteinen geziert. Dies sind zunächst einmal nackte Zahlen. Wechselvoll war die Geschichte des Heiligtums. Mit der Errichtung wurde im Jahr 1911 auf Geheiß des Bogd Gegeen begonnen und im Jahr 1913 wurde es geweiht. Ursprünglich galt es als Symbol der gerade gewonnenen Unabhängigkeit der Mongolei. Gleichzeitig war sie mit dem Wunsch verbunden, das nachlassende Augenlicht des greisen Bogd möge sich bessern. Die Bewohner von Ulaanbaatar nennen die Statue daher auch „Buddha des Augenlichts“. Im Zuge antilamaistischer Ausschreitungen, haben die Russen die Statue regelrecht entführt. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Wahrscheinlich ist, dass sie als Beutekunst irgendwo in den Kellern eines russischen Museums lagert. Anfang der 90er Jahre wurde von mongolischer Seite der Beschluss gefasst die Statue neu anzufertigen. Auch wenn die Mongolen arm sind, die Kosten von rund ½ Mio. € haben die Gläubigen aufgebracht. Heute erstrahlt sie wieder in ihrer ganzen Pracht; – und für 5 US$ schaut der Wächter auch weg, wenn der Fotograf sich auf die Empore schleicht um einen noch besseren Blick zu haben.
Ein Highlight anderer Art ist die Modenschau bei „Torgo“; das ist ein wenig so etwas wie der mongolische Versace. Junge Designer präsentieren hier ihre phantasievollen Kreationen. Bei traditioneller Musik präsentieren die langbeinigen mongolischen Ausgaben von Claudia Schiffer und Heidi Klum gewagte Schnitte und Stoffe, die alte mongolische Muster und Trachten wieder aufnehmen. Wir lassen den Tag in einem Mongolen-Grill ausklingen. Ich kannte diese Art des Grillbuffets nicht und war überrascht wie lecker das schmeckt, was man sich aus zahlreichen Zutaten selbst zusammenstellen kann. Alle Köstlichkeiten asiatischer Kochkunst kommen auf einen riesigen heißen Stein und werden von den Grillmeistern mit 2 überlangen Messern zerkleinert und gewendet, dazu ein kaltes Khan-Bräu und ein oder zwei Wodka der Marke Chinggis, und man hat die richtige Bettschwere.
Auf nach Norden…
Der neue Tag beginnt so, wie der vergangene geendet hatte: grau, regnerisch, nasskalt. Alagh holt mich am frühen Morgen ab. Eigentlich ist der Toyota Landcruiser weltweit das Fahrzeug der ersten Wahl wenn es um Fahrten in unwegsamem Gelände geht. In der Mongolei sieht man diese Fahrzeuge jedoch selten. Man vertraut entweder auf die Technik des Barkas, ein Vehikel aus der Abteilung „Plaste und Elaste“ ehemaliger DDR Produktion, oder auf die modernen vierradgetriebenen Kleinbusse von Hyundai. Wir werden später noch Gelegenheit haben ein Loblied auf diesen fahrbaren Untersatz zu singen. Schon wenige Kilometer außerhalb von Ulaanbaatar endet die Asphaltstraße und die Piste beginnt. Wir durchqueren den Selenge-Aimak und überschreiten den Orchon. Hier im Norden spürt man die Nähe zu Sibirien. Die Natur ist noch weit zurück, in den Flussniederungen sieht man noch Eiszungen, auch wenn an den satt grünen Ufersäumen bereits die Hyazinthen üppig blühen. Am Nachmittag klart es auf, und die Sonne kommt heraus. Die Tage sind lang. Auch am frühen Abend gibt es noch bestes Licht zum Fotografieren.
Wir entscheiden uns, unser Ger-Camp links liegen zu lassen und besuchen noch am Abend das Kloster Amarbajasglant. Die Novizen sind rot gewandet, die Mönchskutte haben sie an diesem Tag jedoch gegen den Sportdress getauscht. Die Rückennummern sind die von Ronaldinho, Ballack und Rooney. Und so abgeschieden von der Welt dieses Kloster auch liegen mag, die Jungs sind gut über ihre Idole informiert – ob sie, die statt mit Fußballschuhen barfuss kicken, eine Vorstellung davon haben welche Summen diese Edel-Balltreter verdienen, darf man bezweifeln. Das Kloster, dessen Gründung ins Jahr 1717 zurückgeht, wurde nach 1990 aufwendig restauriert. Die glasierten Ziegeldächer der einheitlich im chinesischen Stil errichteten Gebäude strahlen schon von Ferne i der Sone. Mit dem Lama vereinbaren wir einen Besuch für den kommenden Morgen um die Innenräume zu besichtigen.
Unser Ger-Camp liegt nur wenige Kilometer vom Kloster entfernt. Jurten kenne ich aus Usbekistan, Kasachstan und Kirgistan; und bin sehr überrascht wie geschmackvoll und bequem diese Wohnstätten in der Mongolei ausgestattet sind. Die 10 – 20 Jurten eines Camps sieht man schon von weitem. Wie kleine, weiße Champignons stehen sie in der Landschaft. Sauberkeit wird großgeschrieben. In der Regel hat jedes Camp ein Toiletten- und Badehaus sowie eine große Zentraljurte, wo man sich zum gemeinsamen Abendessen trifft. Die Jurten haben einen festen Fußboden, verfügen über elektrisches Licht und einen Ofen. Im Mai ist es nachts noch empfindlich kalt. Auch wenn man sich innerlich mit reichlich Wodka gewärmt zu haben glaubt, ist man froh wenn man abends in die Jurte kommt, in der es mollig warm ist und wo im Ofen die Holzscheite knistern.
Der Morgen empfängt uns mit strahlendem Sonnenschein. Bereits um 5:00 Uhr ist es glockenhell. Als ich die Tür der Jurte aufstoße, sehe ich unweit des Camps ein Nomadenlager. Die Leute staunen nicht schlecht, als die Hunde anschlagen und ich unvermittelt bei Ihnen auftauche. Trotz der frühen Stunde, ist die ganze Familie bereits auf den Beinen. Vater und die kleine Tochter versorgen und satteln die Pferde, auf dem Herd vor der Jurte köchelt ein Haferbrei vor sich hin, und die Jungs sammeln Kuhfladen zum Trocknen als späteres Heizmaterial. Außer von einem störrischen Ziegenbock, der mich verfolgt, werde ich herzlich willkommen geheißen. Leider ist die Kommunikation schwierig; mit Händen und Füssen wird gestikuliert. Als ich mich verabschiede habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir einander verstanden haben.
Frühstück fällt an diesem Morgen flach, dafür ist der fotografische Hunger fürs Erste gestillt. Das Kloster Amarbajasglant ist traumhaft gelegen. Es liegt eingebettet in eine hügelige Graslandschaft. Jetzt, Anfang Juni, sind die Wiesen von einem satten Grün, das ab und an von einem Farbtupfer aus violetten oder gelben Krokussen durchsetzt ist. Es lohnt eine der Anhöhen zu erklimmen und einen Blick von oben auf die Klosteranlage zu werfen. Während ich dort stehe und schaue, fällt mir der Buchtitel des Walisers Richard Llwellyn ein „So grün war mein Tal“. Das könnte auch hier sein, genau an diesem Aussichtspunkt. Durch das Teleobjektiv sehe ich einen der Lamas vor dem Klostertor, der wartet um uns willkommen zu heißen. Den frommen Mann soll man nicht warten lassen. Die Novizen, die gestern noch so unbeschwert auf dem Bolzplatz gegen den Ball traten, sind an diesem Morgen mit Eifer und Konzentration beim Lernen. Na ja, – vielleicht nicht alle. Der eine oder andere lässt sich gerne durch die Kamera ablenken. Das bleibt nicht aus, auch wenn man sich im Hintergrund hält. Dem Seelenheil der jungen „Gelbmützen“ wird es wahrscheinlich nicht geschadet haben. Die Innenräume des Klosters sind reich geschmückt. Den „aufgeräumten Eindruck“ stört ein wenig, dass der große Haupttempel voll gestopft mit Säcken ist, die alle ein Kraut enthalten, von dem jeder am Ende des Besuches ein Tütchen voll geschenkt bekommt. Den Sinn vermochte ich bislang nicht zu ergründen, denke mir aber, dass es wohl zum Verbrennen gedacht ist, und dass der Rauch die guten Wünsche und Gebete gen Himmel tragen soll.
Wir wollen weiter nach Norden, in den Uran Togoo Nationalpark, in dessen Mitte drei erloschene Vulkane stehen. In der Kaldera eines dieser ausgebrannten Feuerspucker soll sich ein See befinden. Dass dieser See immer gut gefüllt sein wird, darum muss man sich nicht sorgen. Dieser Tag hat biblische Ausmaße. So muss es gewesen sein, als Gott der Herr im Zorn die Sintflut auf die Erde niederprasseln ließ, wobei mir die Beschreibung von Regen á la Forrest Gump zutreffender erscheint: „Wir hatten Regen von oben und unten, Regen mit dicken Tropfen., Schnürlregen, Sprühregen, Regen von der Seite“. Kurz gesagt: die Welt hatte sich verdunkelt, die Pisten verschlammt. Zum Teil hatten selbst unsere geländegängigen Fahrzeuge Schwierigkeiten voranzukommen. Irgendwann war die Temperatur soweit gesunken, dass aus dem Regen Schnee und Graupel wurden. Während Alagh sich auf’s Fahren konzentrierten musste, höre ich ein Hörbuch mit dem Titel „Same, same but different“ und dachte: das passt doch.
So ein Ger-Camp im Regen hat auch nichts wirklich Aufregendes, außer dass man ein trockenes Plätzchen hat und hofft, dass der Filz der Jurte nicht irgendwann durchgeweicht ist. Selbst auf dem kurzen Weg von meiner Jurte bis zur Restaurant-Jurte werde ich klitschenass – und dann fällt auch noch der Strom aus ! Nachdem der Benzinfilter des Stromerzeugers gereinigt ist, und das Aggregat wieder tuckert, beginnt ein „mongolischer Feger“ mit dem Servieren. Die junge Frau hat sich für die Gäste richtig aufgebrezelt und trägt zu einem stylischen Großstadt-Outfit Stiefel mit High-Heels. Irgendwie scheint mir dieses Schuhwerk für die mongolische Steppe eher ungeeignet.
Eigentlich sollte man meinen, dass der Himmel irgendwann seine letzte Träne vergossen haben sollte, doch auch am kommenden Morgen regnet es heftig. Da sind die vor uns liegenden 300 km Fahrt bis zum Hovsgol Nuur nur mit dem Wunsch verbunden, dass wir auf unserem Weg irgendwo eine Wetterscheide passieren und der Regen ein Ende nimmt. 300 km, das ist für uns auf unseren Autobahnen keine Distanz; in der weglosen, mongolischen Steppe sind das jedoch 12 -14 Stunden anstrengende Fahrt.
Plötzlich stehen wir unvermittelt am Ufer eines großen Flusses und folgen der Uferlinie auf der Suche nach einer Furt. Der Selenge ist der größte Strom der Mongolei. Er fließt nach Norden in den Baikal-See, vereinigt sich vor der russischen Grenze mit dem Orchon und strömt dem Polarmeer entgegen. Hier ist schon die Nähe Sibiriens zu spüren. Jurten weichen Holzhäusern und unter die Mongolen mischen sich Burjaten, die beiderseits der Grenze leben. In der kleinen Distrikthauptstadt Moron machen wir Mittagsrast und füllen unsere Vorräte an Wasser und „Wässerchen“ auf. Der Weg weiter nach Norden führt durch hügeliges Grasland das von zahllosen Bachläufen durchzogen ist, deren Ufersäume noch schnee- und eisbedeckt sind. Schon nach wenigen Tagen gewöhnt sich mein Auge an die Weite. Der Blick kann unverstellt schweifen. Allenthalben sieht man in der Ferne einzelne Jurten. Von weitem bereits am Rauch, der aus dem Ofenrohr quillt, zu erkennen. Auf den weiten offenen Flächen grasen Pferde. Und endlich hat Petrus ein Einsehen und stellt die Himmelsschleusen ab. Ganz vorsichtig lugt die Sonne hervor als wir den Hovsgol See erreichen.
Am Hovsgol Nuur…
…haben wir eigentlich eine Verabredung mit einem Führer, der uns in die Berge zu den Zaatan bringen wollte. Die Zaatan sind tuwinische Nomaden, die im Land an der sibirischen Grenze von der Rentierzucht leben. In ihrem isolierten Lebensraum am Rande der Zivilisation haben sie sich die Bräuche Ihrer Vorväter erhalten. Hier gibt es sie noch, die Schamanen; jene vom „heiligen oder unheiligen“ Geist beseelten Männer und Frauen, die sich in Trance singen oder tanzen um mit ihren spirituellen Kräften Kranke zu heilen oder in die Zukunft zu sehen. Als ich mit Sosor am Abend am Seeufer entlang schlendere zieht er die Augenbrauen hoch, als er sieht, dass der See noch vollkommen zugefroren ist. Nur am Ufersaum haben sich schon einige offene Waken gebildet. Sosor meint, dass die Nomaden sicher noch in ihrem Winterlager sind. Wir treffen auf einen Yak-Züchter, der diese Vermutung bestätigt. Unser Vorhaben müssen wir also leider aufgeben. Dafür hat uns der Bauer für den kommenden Tag zu sich eingeladen, und es wäre „unhöflich“ eine solche Einladung auszuschlagen.
Bascha managt unser Camp am Hovsgol See. Sie ist ein wahrer Schatz – und ein bildhübsches Mädchen obendrein. Wir sind in dieser Saison die ersten Gäste im Camp, und alle anderen Camps stehen auch noch leer. Es ist noch zu früh im Jahr. Bei Nachttemperaturen von – 15° C kommen keine Touristen. So kann Bascha ihre ganze Aufmerksamkeit auf uns richten. Das abendliche Lagerfeuer wärmt nur die den Flammen zugewandte Körperhälfte. Die Kälte kriecht uns den Rücken hinauf. Bascha erzählt, dass sie aus Ulaanbaatar kommt, dort für eine Tourismus-Agentur arbeitet, und jedes Jahr im Frühjahr an den See kommt um dort den Sommer zu verbringen. Sie liebt die Weite, das ungebundene Leben und die Pferde. Welcher jungen Frau in Europa könnte man damit eine Freude machen ? Die Hilfskräfte im Camp sind allesamt Studenten, die diese Jobs annehmen um ihr Studium zu finanzieren.
Am nächsten Morgen ist die Luft über dem See klar und es umgibt mich etwas, was wir Städter gar nicht mehr kennen: absolute Stille. Ich bin früh auf den Beinen, will zum Sonnenaufgang am Seeufer sein. Es ist mit – 10° C immer noch recht frisch, dazu kommt ein strammer Wind aus dem Osten. In der Ferne treten hohe Berge aus dem Hochnebel. Vereinzelt stehen am Seeufer Lärchen und Kiefern; auf dem kargen Permafrostboden sind sie wahre Überlebenskünstler und werden nicht sehr groß. Der Ufersaum ist mit blanken, glatt geschliffenen Kieseln bedeckt. Ein einsamer Steg ragt in den See hinein. Dort wo der Wind das Eis gegen das Ufer geschoben hat, haben sich große Eisschollen übereinander geschoben. So muss der liebe Gott sich das gedacht haben, als er die Welt gemacht hat. Oder wie Zuckmayer seinen Harras im Teufels General sagen lässt: „…die Welt ist schön. Wir Menschen geben uns alle Mühe sie zu versauen – aber wir kommen gegen das ursprüngliche Konzept nicht an. Und das ist gut !“
Nachdem Sosor und Alagh wach sind, machen wir uns auf um unseren neuen Freund den Yak-Bauern und seine Herde zu suchen. Die Herde ist schnell gefunden. Sie grast am Seeufer, wo die Gräser schon fett und saftig sind. Sosor’s Geschick beim Treiben der Herde verrät seine nomadischen Wurzeln. Trotz seiner 82 Jahre ist er fit und schafft die verzottelten Hochlandrinder in die richtige Position vor die Kamera. Vom Bauern und seiner Familie weit und breit keine Spur. Da muss man sich durchfragen, und das ist in einem so dünn besiedelten Land wie der Mongolei nicht einfach. Wir treffen einen alten Mann mit einem Hund, der sagt er wolle uns den Weg weisen.
Es geht steil Berg an. Die Kulisse erinnert ein wenig an die Schweiz. Als wir die ersten Gatter und Umzäunungen passieren, wissen wir, dass wir hier richtig sind. Der Bauer und seine ganze Familie tragen ihre besten Kleider. Schließlich will man auf Fremde, die so selten hierher kommen, einen guten Eindruck machen. Mit Großeltern, Eltern, Brüdern, und Kindern leben in diesem Lager 15 Personen. Jeder hat seine feste Aufgabe. Die Brennholzvorräte müssen ergänzt werden, herangeschleppte Baumstämme werden zersägt und in Scheite gespalten. Die Großmutter ist am Buttern. Große Stücke gesalzener Yak-.Butter liegen schon in nasse Tücher gewickelt auf einer Holzbank. Wir begleiten die Hausfrau und die beiden heranwachsenden Töchter in den Yak-Kindergarten. Bevor die Kälber sich an Mamas Zapfstelle bedienen dürfen, werden die Yaks gemolken. Gar nicht so einfach unter dem zotteligen Fell die richtige Stelle zu finden. Flink ziehen die Finger an den Zitzen des Euters und die nahrhafte Milch rauscht nur so in den Eimer. Natürlich wird der Gast gebeten es gleich zu tun, und wie immer scheitert der Versuch unter großem Gelächter der Umstehenden kläglich. Als wir ins Lager zurückkehren sitzt Sosor auf einem Stein und schreibt eifrig in ein Oktavheft. Da ich, die mongolischen Schriftzeichen nicht lesen kann, frage ich nach. Sosor war nicht nur Lehrer, sondern ist auch Schriftsteller und Philosoph. Er schreibt die Geschichte eines alten Mannes mit seinem Hund, der uns hierher geleitet hat. Der Alte ist Kriegsveteran und arbeitete während der kommunistischen Zeit in der öffentlichen Verwaltung; – was wahrscheinlich bedeutet, dass er ein Parteibonze war. Er ist „Held der Arbeit“ und hat trotzdem so wenig geleistet, dass ihm der heutige mongolische Staat nur eine Rente von 40.000 Tugrik im Monat zubilligt. Das sind nicht einmal 30 €.
Zum Sterben zuviel und zum Leben zu wenig. In Sosors Essay unterhält der Erzähler sich mit einer Elster, die auf dem Ast eines Baumes sitzt über die Grausamkeiten, die Menschen einander antun. Wir sind von seiner Erzählung so angerührt, dass der alte Mann uns am Ende des Tages mit einer zusätzlichen Monatsrente, und einem unvergesslichen Lächeln, bei dem er den zahnlosen Mund verzieht, verlässt.
on the road again…
Wobei die Bezeichnung “road” sicher zu einer falschen Vorstellung verleitet. Von den fast 3.500 km, die wir in der Mongolei zurückgelegt haben, waren nur gut 150 km asphaltiert. Zumeist bewegt man sich auf unmarkierten Pisten in der Steppe. Alagh scheint mit geradezu hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet zu sein. Selten verfehlen wir unseren Weg. Es ist die angeborene Fähigkeit des Nomaden, der weder Wegweiser noch Karten oder GPS braucht. Bevor wir zur Brücke über den Selenge kommen, müssen wir eine heikle Stelle passieren, an der Schmelzwasser unter einer noch mit Harschschnee bedeckten Wegstrecke herausströmt. Man kann den Untergrund nicht sehen, sicherheitshalber gehe ich mit einem Skistock voran und lote aus, wo Gefahren drohen. Die Brücke über den Selenge ist eine Konstruktion aus „sowjetischer Zeit“, die eindeutig bessere Tage gesehen hat. Der Traglastangabe, die ein Spaßvogel in kyrillischer Schrift mit 20 to. auf ein altes Stopp-Schild gemalt hat, kann man nicht trauen. Der Holzkonstruktion fehlen schon einige Stützen und der hölzerne Fahrbahnbelag hat große Lücken. Darunter strömt der Fluss, breit und reißend dahin. Da hilft auch kein Skistock. Da heißt es „Augen auf – und durch“.
Am späten Nachmittag wird unser Auge von einigen merkwürdigen dunklen Punkten angezogen, die aus der grünen Steppe ragen. Sosor erklärt das seien Hirschsteine. Eine kurze Nachfrage, entlockt Sosor immer eine weitschweifige Antwort. Kurz und knapp zusammengefasst. Hirschsteine sind Stelen, welche ihren Namen den Gravuren verdanken, die zumeist Hirschmotive darstellen. Die Hirschsteine markieren Begräbnisplätze von bedeutenden Personen aus der Zeit des Übergangs von Bronze- zu Eisenzeit.
Nicht weit von hier liegt unser Tagesziel der Zuun Nuur. Schon bei der Annäherung an den See kann man Schwärme von Zugvögeln sehen, die aus dem Süden in Ihre Brutgebiete zurückkehren. Über dem Zuun Nuur erstreckt sich im Abendlicht ein weiter Himmel mit Schäfchenwolken, und vor dieser traumhaften Kulisse liegt unser Ger-Camp. Schon von weitem sieht man, dass die Jurten schon geheizt werden. Über den Ofenrohren flirrt die Luft. Auch hier sind wir die ersten Gäste in diesem Jahr. Das Camp wird von einer Familie bewirtschaftet. Tourismus in der Mongolei ist umweltverträglich. Die Ger-Camps werden im Herbst abgebaut. Wenn man die Plattformen entfernt, auf denen die Jurten aufgebaut werden, bleibt unberührte Natur zurück. So etwas nennt man auf neudeutsch „Nachhaltigkeit“.
Als ich in der Nacht wach werde und vor die Jurte trete spannt sich über mir ein traumhafter Sternenhimmel. Die Luft ist so klar, dass man alle Himmelskörper gut sehen kann. Den Polarstern, den großen und kleinen Wagen, und den Orion. Das Mondlicht lässt den See silbern glänzen, und es ist über dem See fast so hell, als sei der Tag nicht mehr fern. Die Szenerie hat etwas aus einem Kinderlied: „Weißt du wieviel Sternlein stehen – an dem blauen Himmelszelt“
Tschechen-Camp am Terkhin Tsagaan Nuur
Auf der langen Fahrt zum „Weißen See“ treffen wird viele Nomaden. Mit allen Vehikeln die Räder haben wird Mensch und Hausrat transportiert. Bis zu 4 Personen gehen auf ein Moped, 15 Mann in einen Kleinbus; und ein uns noch wohlbekannter LKW der Marke IFA hat fast unbegrenzte Kapazitäten. Da passen neben der Sippe, dem Hausstand auch noch Schafe und Ziegen drauf. Wer so waghalsig auf Reisen geht, der benötigt dringend göttlichen Beistand. So nimmt es nicht Wunder, dass an gefahrvollen Stellen, Bergen und Passhöhen überall im Land Opferstellen entstanden sind. Weithin sichtbar sind diese Owoos von denen blaue Khadag-Schleifen im beständig wehenden Wind flattern; Zeichen für eine Volksreligion, die fest im Leben der Nomaden verwurzelt ist. Wer einen solchen Owoo passiert ist verpflichtet drei Steine zum Steinkegel hinzuzufügen und den Owoo dabei drei Mal im Uhrzeigersinn zum umrunden. Skurriler sind die dort hinterlegten Opfergaben. Wer in Lourdes war wird: „das mit den Krücken“ verstehen. Bei abgefahrenen Fahrradreifen, Ziegen- und Schafsköpfen oder Wodkaflaschen kommt man in Erklärungsnot. Zugegebenermaßen sind es leere Wodkaflaschen; – übertreiben soll man das mit dem opfern auch nicht!
Dass unser Opfer angenommen wurde stellt sich kurz vor unserer Ankunft am Terkhin Tsagaan Nuur heraus. Der intensive Regen der letzten Tage hat alle Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen lassen. Mitten im Nichts treffen wir auf junge Leute, die am Ufer eines Flusslaufes sitzen, zur Gitarre ein paar Liedchen trällern, während sich einige abmühen ihren „geländegängigen Barkas“, mit dem sie sich in der Flussmitte festgefahren haben, wieder flott zu machen. Alagh macht eine bedenkliche Miene. Wir versprechen Hilfe zu schicken.
Nach gewissenhafter Inspektion setzen wir zur Flussquerung an; – und tatsächlich es gelingt. Wahrscheinlich nur wegen des Opfers und weil ich die Luft angehalten habe als wir in der Flussmitte ein Loch trafen und sich der Schwall des Wassers über die Motorhaube ergoss und die Windschutzscheibe überflutet.
Spät abends treffen auch die jungen Leute im Ger-Camp am Terkhin Tsagaan Nuurein ein, das sich im Schatten des Chorgo-Vulkans duckt. Wir kommen ins Gespräch und erfahren, dass sie aus der Tschechei kommen und eigentlich eine Campingtour machen. Geld für ein Ger-Camp war in ihrem Budget nicht vorgesehen, so belegen sie nur 2 Jurten und übernachten in jeder mit 10 Personen. Wir sitzen noch lange beisammen. Am Ende liegen zahlreiche leere Flaschen Dschingis Gold; des milden mongolischen Wodkas, rund ums Lagerfeuer; und da man sich die komplizierten mongolischen Namen nicht merken kann, bekommt dieser Ort den Namen „Tschechen-Camp“.
…it never rains in Southern California !
Aber dafür regnet es in diesem Juni in der Mongolei ohne Unterlass. Auf dem Weg nach Tsenkher kommen wir wieder bei Nomaden vorbei. Wir halten an, und fast im gleichen Moment öffnet sich die Tür zur Jurte und wir werden eingeladen. Nicht nur unsere Wohnjurten in den Ger-Camps sind schick eingerichtet. Auch wenn die Leute auf dem Land keine Reichtümer anhäufen können, ihr Zuhause ist praktisch und sauber eingerichtet. Auf wenigen Quadratmetern eine ganze „Wohnwelt“ mit Kochstelle, guter Stube und Schlafstellen. Schnell wird ein Milchtee und Fettgebackenes gereicht, und die Kinder wuseln zwischen unseren Beinen herum. Auf meine Frage und Bitte setzt sich die ganze Familie für ein Familienfoto vor ihre Heimstatt. Von der kleinen Tochter der Familie gelingt mir trotz des verhangenen Himmels ein Foto, das ich zu meinen schönsten Portraits zähle. Sie schaut selbstbewusst in die Ferne, der Wind spielt mit ihrem langen, lockigen braunen Haar, so dass sie fast wie eine Medusa ausschaut.
Nachmittags erreichen wir den Felskoloss von Tsenkher. Einem Inselberg gleich, hält er als verlassenes Monument die Erinnerung an die letzte Eiszeit wach. Wie gigantisch die Gletscher waren und welche Kräfte gewirkt haben, die diesen Felsklotz von den Bergen in die Steppe geschoben haben, kann man sich kaum vorstellen.
In der Provinzhauptstadt Tsetserlig wollen wir unsere Vorräte ergänzen und das Kloster Tsajain Churee besuchen. Am späten Nachmittag verfinstert sich der Himmel, wir erledigen die Einkäufe, stellen fest, dass das Kloster eigentlich ein Museum ist, das geschlossen hat, und machen uns auf den Weg. Kurz darauf bricht die Hölle los. Auch der Owoo ,den wir gerade passiert haben, nutzt uns nichts. Es regnet und hagelt so stark, dass wir stoppen müssen. Die Fahrzeuge rutschen auf dem nassen Gras zur Seite weg, da nutzt auch der Allradantrieb nichts, und die Sicht liegt bei Null. Wollen wir nicht riskieren in ein Loch zu fahren und zu kippen, ist hier Endstation – vorläufig zumindest. Während wir bereits überlegen, wie wir die Nacht in dem kleinen Fahrzeug verbringen können, zieht Alagh genüsslich an seiner Zigarette und Sosor ist schon wieder eingenickt. Als der Regen eine kleine Pause macht, schaffen wir die letzten Kilometer bis zum Duut-Resort. Ein Highlight für den müden Reisenden. Ein neu errichtetes Ger-Camp; Jurten mit „dichten Dächern“, ein gemütliches Restaurant mit offenem Kamin, warmen Duschen, Fernsehempfang (was sich noch als wichtig erweisen wird) Nach dem Abendessen sitzen wir noch ein wenig am Kamin, einen Wodka im Glas, als mein Freund Helfried meint :“Ist heute nicht das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft ?“ In der Tat. Beim Durchzappen durch die Programme bleiben wir an einem Fußballspiel hängen. Das Bild ist verschwommen und ruckelt. Wer da gegen wen spielt ist nicht zu erkennen. Na gut, Südafrika ist ja auch weit weg. Wir rechnen die Zeitverschiebung zurück und kommen zu dem Ergebnis, dass das Spiel erst weit nach Mitternacht zu Ende sein wird. Wir machen mit der kleinen Mongolin, die kaum über den Bar-Tresen gucken kann, aus, dass sie uns am folgenden Morgen das Ergebnis sagt. Das einzige was am nächsten Morgen strahlend ist, ist das Lächeln unserer Barmaid. Südafrika gegen Mexiko 3 : 1 ! – Im übrigen regnet es immer noch. Erst als ich Tage später Kontakt mit der Heimat habe, erfahre ich, dass das Resultat nicht stimmt. Mongolen haben es halt nicht so mit der „schönsten Nebensache der Welt“. Reiten, Ringen, Bogenschiessen, das sind Sportarten für richtige Männer.
…let my people go
sagte Mose zu Pharao und führte sein Volk in die Freiheit, natürlich nicht bevor er das Rote Meer mit seinem Stab geteilt hat. So ähnlich ergeht es uns an diesem Morgen. Der Regen hat aufgehört aber weite Flächen des offenen Graslandes sind überschwemmt. Als wir auf einer Anhöhe halten denke ich zunächst, dies sei wegen der Aussicht auf die Jurten unten im Tal, die wie auf einer Insel von zwei reißenden Bächen umspült werden. Schon bald sind wir umringt von einer Kinderschar, zu der sich kurz darauf Männer auf Pferden gesellen, die eindringlich mit Alagh und Sosor diskutieren. Ich gebe in der Zwischenzeit den guten Onkel, mache Scherze und verschenke Bonbons an die Kinder. Die Kinder biegen sich vor Lachen. Den jungen Mädchen hat man die kleinen Brüder zum „hüten“ überlassen. Die Augen strahlen und die Zöpfe wippen lustig in die Kamera. Ich mag Kinder sehr. Der amerikanische Medienkritiker Neil Postman hat einmal geschrieben: „Kinder sind lebende Botschaften, die wir einer Zeit übermitteln, an der wir selbst nicht mehr teilhaben werden“. Eine solche Botschaft habe ich an diesem Tag erhalten. Von einer der Jurten, die das Wasser fest umschlossen hat, löst sich ein kleiner blauer Punkt und beginnt zu laufen, hält am Ufer inne, zieht offenbar die Schuhe aus, durchwatet den reißenden Bach und stürmt bergan. Oben angekommen, entpuppt sich der blaue Punkt als kleines Mädchen, das mich anstrahlt, mir die Hand entgegenstreckt und scheinbar sagen will: „Vergiß mich nicht“ ! Ihr schickstes Kleid hat sie angezogen, die Gummistiefel immer noch unter dem Arm. Es sind diese kleinen Begegnungen, die für mich eine Reise zu einem Erlebnis werden lassen.
Gleich nach dem Erlebnis kommt das Abenteuer. Wir müssen beide Flüsse queren. Ein umfahren ist unmöglich. Der Reiter, der versucht hat durch den ersten Fluss zu kommen, ist samt Pferd gestrauchelt und abgetrieben worden; hat sich nur mit Mühe wieder ans Ufer retten können. Die Siedlung verfügt über einen Traktor, der soll uns jetzt durch die Flüsse ziehen, doch auch hier sind die ersten Versuche nicht von Erfolg gekrönt. Wieder folgt ein langes Palaver. Alagh dichtet Auspuff und Luftfilter ab und ich sinne darüber nach, ob unser Kleinbus nicht vollaufen wird wie eine Badewanne, wenn das Wasser die großen Räder des Traktors schon überspült. Wenigstens hat der Traktor Ketten auf die Räder gezogen. Erst später erkenne ich, dass das keine Ketten sind, sondern nur verhindern, dass der morsche Gummi der Reifen sich nicht vollständig auflöst. Wir haben es geschafft ! – …und ich danke den koreanischen Autobauern, dass sie Türdichtungen konstruiert haben, die ihren Namen wirklich verdienen. Wir winken unseren Helfern vom anderen Ufer noch einmal zu und haben uns schon aus den Augen verloren.
Om mani padme hum
Das buddhistische Mantra ziert alle 108 Stupas, die die Hauptmauer des Klosters Erdene Zuu begrenzen. Die Klosteranlage misst in Länge und Breite 420 m. Während die meisten Besucher sofort ins Innere der stürmen, nehme ich den Weg der Pilger und umrunde zunächst das Kloster. Ein gläubiger Buddhist würde vor jedem Stupa verharren, der gläubige Fotograf sucht nach den einzigartigen Perspektiven an den Ecken der Umfassungsmauer, wo die Stupa ein Dreieck bildet und der Blick in die Weite führt oder verführt. Oh Du Juwel im Lotus! Es ist ein traumhafter Tag. Ich kann mich nicht satt sehen an der Szenerie. Die weißen Stupas, die sich gegen den dunkelblauen Himmel abheben, gehören zu den Sternstunden dieser Reise. Vor dem Tor haben sich wie so oft fliegende Händler versammelt. Hier kann man den Tand kaufen, von dem schlichte Gemüter glauben man müsse ihn besitzen: Amulette gegen den bösen Blick, Gebetsketten, Gebetsfahnen und Gebetsmühlen, außerdem Bier, Fanta, Cola. Zu den Händlern gesellen sich die Schausteller, die in mongolischer Reiter-Rüstung mit einem Steinadler auf dem Arm als Dschingis Khan posieren. Im Klosterinneren treffe ich „Bruder Tuck“. Zumindest sieht das „feiste Mönchlein“ so aus als sei er Bruder Tuck aus der Robin-Hood-Saga. Eigentlich ist er gar kein Mönch. Er verleiht traditionelle Kleider, in denen sich Touristen fotografieren lassen können. Die Gründung des Klosters geht zurück auf das Jahr 1586. Awdaj Sajn Chan ließ es auf den Ruinen von Dschingis Khan’s alter Hauptstadt Karakorum errichten. Bis zu 10.000 Lamas sollen hier gelebt und gebetet haben.
Erdene Zuu hat immer schon Begehrlichkeiten geweckt. In den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Mandschuren wurde das Kloster Mitte des 18. Jahrhunderts stark beschädigt. Nachdem die Kommunisten 1941 die Macht übernommen hatten, wurde der Klosterbetrieb bis 1990 eingestellt und dem Bildersturm fiel unter anderem die umfangreiche Klosterbibliothek zum Opfer. Auch wenn die Einnahmen des Klosters spärlich fließen, kann man heute wieder vieles von der ehemaligen Pracht erkennen. Drei große Tempel, ein Stupa und mehrere Nebengelasse, wurden im originalen chinesisch-tibetischen Stil rekonstruiert, und auch das mönchische Leben hat wieder Einzug gehalten. Mehrmals am Tage werden Gottesdienste zelebriert.
Während ich buddhistische Mönche überall in Asien als aufgeschlossene, weltoffene und vor allem humorvolle Glaubensmänner kennen gelernt habe, sind die Mönche von Erdene Zuu eher „fotografierunwillig“. Vielleicht liegt das ein wenig daran, dass fast alle Mongolei-Touristen hierher kommen und die Mönche sich ein wenig vorkommen wie im Zoo. So bleibt mir hier nur das Foto von „Bruder Tuck“. Die Innenräume der Tempel erstrahlen in alter Pracht. Goldene Bodhisatva-Statuen, Abbilder von Milarepa, Geistermasken aus dem Bön-Glauben, Gebetstrommeln, Schellen, Trompeten und hunderte von Gebetsmühlen, die die Gebete der Pilger gen Himmel tragen. Ich baue mein Stativ auf und sehe aus den Augenwinkeln wie einer der Tempelwächter heranstürmt. Au wei ! – denke ich; gleich gibt’s Ärger, doch das genaue Gegenteil geschieht. Er schaut auf mich und meine Kamera, grinst mich an und räumt auch noch die letzten Barrieren auf die Seite.
Wenn man das Kloster durch das rückwärtige Tor verlässt, bewegt man sich auf geschichtsträchtigem Boden. Wir wandeln auf der Ebene, aus der sich einst Karakorum, die alte Hauptstadt Dschingis Khans erhob. Nichts ist geblieben von der Stadt, von der aus einst die Hälfte der Welt beherrscht wurde. Von hier sind sie aufgebrochen, die mongolischen Reiterhorden, die ganz Kleinasien überrannten und ins Herz Europas vordrangen. Einzige Relikte aus jener Zeit sind zwei steinerne Schildkröten, die wohl zu schwer waren, als dass man sie hätte fortschleppen können. – Aus, vorüber, vorbei; der letzte Vorhang für Karakorum ist gefallen.
…“wo immer die Welt am schönsten war…
…da war sie öd und leer !“ Diese Worte legt Theodor Fontane seinem Archibald Douglas in den Mund. Sie beschreiben die Sehnsucht des Protagonisten nach seiner grünen, englischen Heimat. Für mich gilt das im wörtlichen Sinne. Ich liebe die Wüste und die öden Landstriche, weil sie den Menschen auf das reduziert was er ist: ein Staubkorn in Raum und Zeit. Die Wüste ist sauber und rein. Am späten Nachmittag erreichen wir den Rand der Gobi. Sandflächen aus gelbem und schwarzem Sand wechseln einander ab. Dazwischen Inseln mit Saxaul-Bäumen; – anspruchslosen Gräsern und Salzgewächsen. Man kann die Stille mit Händen greifen.
Nicht weit von hier liegt unser Nachtlager das Ger-Camp von Bayangobi. Als wir eintreffen steht ein Polizeifahrzeug vor dem Camp und auf dem Gelände tummeln sich Menschenmassen. Bisher waren wir in den Ger-Camps immer allein und ich denke mit Grauen an den Lärm, den diese Menschen in der Nacht wohl machen werden, wenn „anständige Fotografen“ schlafen wollen. Als ich meinen Seesack zur Jurte schleppe, begegnet mir ein barhäuptiger Herr in einem goldenen Mantel. Ich beschleunige meinen Schritt, schnappe mir die Kamera und hefte mich an seine Fersen. Auf die Frage, ob ich ihn fotografieren darf, lacht er nur und fragt: „where are you from ?“ Ich antworte: „from Germany“. Er lacht wieder und meint: „I know that – Munich, Bavaria – very good beer!“. Und natürlich darf ich ihn auch fotografieren. Am Ende fragt er, ob ich ihm die Bilder schicken kann und drückt mir seine Visitenkarte in die Hand. Auf dieser steht: Dr. Prof Khamba Lama Natsagdorj vom Zentrum für traditionelle mongolische Medizin in Ulaanbaatar. Die Menschen, die uns umringen sind allesamt Pilger. Zu unserer Runde gesellt sich ein weiterer Lama und der „Professor“ sagt: „may I introduce my dear friend Lama Chilkhaasuren Tsedendamba to you ?“ Der Mann hat eine verblüffende Ähnlichkeit und auch die gleiche Herzlichkeit des Dalai Lama. Lama Chilkhaasuren meint, dass ich mich glücklich schätzen könne, ausgerechnet heute hier zu sein, wo der Bogd Gegeen den Pilgern seinen Segen spende. Von diesem Mann hatte ich noch nie gehört und musste lernen, das der Bogd Gegeen nach dem Dalai Lama und dem Panchen Lama der dritthöchste Würdenträger in der lamaistischen Hierarchie ist. Lama Chilkhaasuren drückt mir eine blaue Khadag-Schleife in die Hand und ich reihe mich in die Reihe der wartenden Pilger ein. Der Bogd Gegeen ist schon über neunzig Jahre alt, sitzt im Rollstuhl, lebt eigentlich im indischen Dharamsala und nimmt trotzdem die Mühsal der weiten Reise auf sich. Für mich wird die Segnung und vor allem die Fotos der Pilger zu einem unvergesslichen Erlebnis. Als die Sonne hinter dem Horizont versinkt, haben sich die Pilger in alle Winde zerstreut, und auch der Bogd Gegeen mit den ihn begleitenden Lamas haben sich auf den Weg gemacht. War all dies wahrhaftig oder nur ein Traum ?
Traumhaft in einer wilden rauen Landschaft gelegen ist auch die Ruine des Klosters Ongig. In der Ferne liegen die schneebedeckten Gipfel des Altai, durch das Tal am Rand der Gobi strömt der Ongi Fluß. Am frühen Morgen liegt ein fast unwirkliches Licht auf dem Tempel. So früh mögen aber weder Alagh noch Sosor aufstehen, und ich mache mich alleine auf den Weg und genieße die Ruhe und den Frieden der frühen Stunde. Trotzdem bin ich nicht alleine. Am Flussufer treffe ich ein kleines Mädchen, viel zu dünn angezogen für die Kälte und zwei Milchkannen schleppend, mit denen die Mutter sie zum Wasser holen geschickt hat. Sie strahlt, als ich ihr die schweren Kannen abnehme und zockelt hinter mir her. Ihre Familie lebt in einer Bretterbude inmitten der Ruinenstadt und wacht über die Trümmer. Einiges ist schon wieder aufgebaut und manches gewinnt auch durch seine Unfertigkeit. Am Rande der Anlage steht ein kleines, rotes Türmchen, zu dem einige Stufen hinaufführen. Gegen die schroffen Berge und den hohen Wolkenhimmel hebt es sich ab wie in dem Led Zeppelin Song – Highway to heaven !
die Sandkiste vom lieben Gott
Fern am Horizont gerät etwas in Bewegung und kommt auf uns zu. Trampeltiere, – eine ganze Herde ! Zwei Treiber scheuchen die ansonsten nicht aus der Ruhe zu bringenden Wüstenschiffe im Galopp vor sich her. Stellt man sich Ihnen in den Weg, läuft die Herde auseinander. Die beiden Mongolen sind nicht böse, dass wir ihre Arbeit stören. Im Gegenteil. Im Gleichklang der Wüste ist ein wenig Abwechselung immer willkommen. Wir erfahren, dass die Nomaden ihr Lager weiter im Süden im Windschatten einer hohen Dünenkette aufgebaut haben und verabreden uns am Nachmittag dort für ein Fotoshooting. Die Beiden machen sich wieder auf den Weg, bringen mit ein paar zackigen Kommandos die Kamele auf Trab und sind kurze Zeit später zwischen den Hügelketten verschwunden.
Nach einer kurzen Suche finden wir am Nachmittag die drei Jurten. Unsere Ankunft wird vom infernalischen Gebell der Hütehunde begleitet. Nahe der Jurte ist ein Geschwisterpaar dabei Kamele zu satteln. Ich staune, mit wie viel Geschick und Umsicht die beiden „Zwerge“ zu Werke gehen, denn sie reichen nicht einmal an den Bauch der Trampeltiere heran. Sie zwingen das Kamel auf die Knie, wuchten den Sattel zwischen die Höker und zurren alles fest, was das Tier je nach Temperament, mit Unmutslauten, Spucken oder Beißversuchen quittiert. Zwischenzeitlich ist ein frischer Wind aufgekommen und peitscht die Sandkörner vor sich her wie in einem Sandstrahlgebläse. Sosor kommt mir strahlend entgegen: „Du wolltest doch sehen, wie eine Jurte abgebaut und auf Kamele verladen wird ? – Ich hab’ das ausgehandelt“. Sosor, das kann man den Leuten doch nicht zumuten ! „Ach“, sagt er, „macht nichts, die freuen sich und das kostet soviel wie ein Kasten Bier“. Na dann bin ich ja beruhigt und wundere mich wie schnell das geht. Mit ein paar Handgriffen ist der ganze Hausrat – inklusive Jurte – in einer knappen Viertelstunde auf dem Trampeltier verstaut. So leicht geht das! Viele Hände schnelles Ende! Als wir uns verabschieden wollen, will man uns gar nicht mehr gehen lassen; und das hat nichts mit der Aussicht auf den Kasten Bier zu tun. Die kleine Tochter des Hauses sitzt auf meinem Schoß und hängt an meinen Lippen. Mit was kann man sich für so viel Gastfreundschaft bedanken? Ein Taschenmesser für den Herrn des Hauses ? Eine kleine Parfümprobe für die Hausfrau? Malstifte, Luftballons und Süßigkeiten für die Kinder ? Wird alles gerne genommen! Trotzdem finde ich, dass solch kleine Geschenke nicht alles sind. Es hat immer so etwas gönnerhaftes. Zu solchen Anlässen krame ich dann mein Unterhaltungsprogramm aus. Zunächst wird deutsches Liedgut malträtiert, „der alte Holzmichel steigt hoch auf den gelben Wagen, der an die schwäb’sche Eisenbahn angehängt von Stuttgart nach Biberach unterwegs ist.“ Außerdem hole ich meinen alten Wasserball mit der Weltkugel drauf aus dem Seesack, blase ihn auf – und siehe da, die Welt ist eine Kugel. Jetzt suchen wir gemeinsam die Mongolei und Deutschland, das macht Spaß und klärt die Relationen. Meine künstlerischen Darbietungen werden mit einem kleinen Geschenk vergolten. Die Herrin von Jurte und Herd schenkt mir einen kleines Säckchen aus Goldfäden durchwirktem roten Brokat, in dem sich drei blank polierte Wirbelknochen eines Schafes befinden. Das ist so eine Art mongolisches Würfelspiel und Schamanen können aus der Art wie die Knochen fallen die Zukunft vorhersagen.
Noch vor Sonnenaufgang wollen wir am kommenden Morgen wieder an diesem Platz sein. Hier gibt es hohe Sicheldünen und der stetig wehende Wind wird alle menschlichen Spuren mit sich davon tragen. An diesem Tag versagt Alaghs inneres Navigationssystem und wir finden die Wüste vor lauter Sand nicht. Er schämt sich und will sich nicht eingestehen, dass er sich verirrt hat. Endlich aber, – kurz bevor die Sonne hinter dem Horizont hervorlugt, finden wir unseren Platz wieder. Aber er ist leer. Die Nomaden sind weiter gezogen zu neuen Weidegründen. Das Bild, welches sich uns bietet, versuche ich erst gar nicht selbst zu beschreiben. Ich leihe mir die Worte eines Wüstenbewohners, der das viel treffender und poetischer kann als ich:
Die Wüste ist es, die mich das Zwiegespräch mit der geheimnisvollen Unendlichkeit lehrte. Die Wüste, das ist das Geheimnis des Windes, der die Dünen vor sich hertreibt und ihnen die seltsamsten Formen mit den reinsten Linien verleiht. (Moustapha Liman Chaffi)
Gegen Mittag erreichen wir bei Bayanzag, die „Flammenden Klippen“. Unweit von hier gibt es einen ganzen Saxaul-Wald, wobei wir Wald einmal mit vielen Bäumen übersetzen wollen. Die verkrüppelten Gewächse erreichen kaum einmal eine Höhe von zwei Metern, aber die fast weiße Rinde und die zarten grünen Nadeln bilden einen wunderschönen Kontrast zur roten Erde und dem dunklen Blau des Himmels. Als sich die Sonne weiter senkt, erglühen die „Flammenden Klippen“ tatsächlich in einem leuchtenden Rot. Mit meinen Freunden Sosor und Alagh sitze ich am Rande der Klippen und wir gönnen uns einen guten Schluck Cognac, den ich für solche Gelegenheiten aufgespart habe. Jeder hängt seinen Gedanken nach und bei mir schwingt schon ein wenig Wehmut mit, dass unsere gemeinsame Reise bald zu Ende gehen wird.
Schools out
Auf unserem Weg zurück nach Ulaanbaatar durchqueren wir den Aimak Mittelgobi. Aimaks, das sind die mongolischen Distrikte, die aber locker die Fläche von Bayern oder Niedersachsen haben. Auf 74.000 km² leben 53.000 Menschen und 1.4 mio. Stück Vieh,vorwiegend Ziegen und Schafe, aber auch Yaks, Pferde und Trampeltiere. Als Alagh durch ein Schlagloch donnert, schreckt Sosor unvermittelt aus seinem Nickerchen auf. Unvermittelt erzählt er: „Weißt Du, ich war in den 60er und 70er Jahren Lehrer in diesem Bezirk. Ich war dafür verantwortlich, dass die Kinder die Schule besuchen und bin bei den Nomaden über Land herumgereist um für den Schulbesuch zu werben. Damals war ein Schulbesuch nicht selbstverständlich. Hast Du nicht Lust eine Schule zu besuchen ?“ Dass Sosor schon ein betagter Herr ist und seine Jahre als Lehrer schon lange zurückliegen, wird deutlich als wir in Mandalgobi ankommen, und die Schule geschlossen ist, weil Ferien sind. Ersatz ist schnell gefunden. Der Kindergarten lädt uns ein. Man stelle sich das in Deutschland vor:
Ein Fotograf, ein Ausländer dazu noch, kommt in einen Kindergarten und fotografiert die Kinder dort. Der Super-Gau für jede besorgte „Helicopter-Mami“. In einer immer anonymer und kälter werdenden Welt argwöhnen wir sofort niedere Motive. In der Mongolei ist das nicht so. Ich bin herzlich willkommen und die Mütter, die Ihre Sprösslinge bringen oder abholen, freuen sich über mein Interesse.
Im Leben gibt es manchmal Türen, die man nicht öffnen und durch die man nicht gehen sollte. Als ich im Kindergarten die Türklinke herunterdrücke; die Tür sich öffnet und in dem Raum dahinter zwanzig Zwerge in bunter Disney-Bettwäsche zum Mittagsschlaf auf Ihren Matten liegen, weiß ich, dass diese Tür nicht dazugehört. Natürlich ist es mit dem Mittagsschlaf jetzt vorbei, aber was soll’s, schlafen kann man auch ein andermal. Alagh holt aus dem Wagen schon die Restbestände unserer Süßigkeiten und das Ganze läuft ein wenig so ab, wie der Kölner Karnevalszug: „Kamelle, de Prinz kütt !“
The last Farewell!
Die Zeit in der Mongolei ist viel zu schnell vergangen; und Zeit, die muss man sich für dieses Land nehmen. Es ist zu schade um nur durchzurasen. Alle Bedenken, dass die Landschaft eintönig sein könnte und man sich in der Weite verlieren könnte, waren unbegründet. Eine Reise in und durch die Mongolei ist zunächst und in erster Linie eine Reise zu den Mongolen. Aus den wilden Steppenkriegern ist eine liebenswertes Völkchen geworden. Viele Geschichten bleiben unerzählt und finden hier keinen Raum, und viele Orte, die wir besucht haben, bleiben unerwähnt. Trotzdem hoffe ich, dass Sie eines Tages Rucksack und Wanderschuhe packen und gen Osten reisen.
Unser Abschied hält noch einen letzten Höhepunkt bereit. Die Agentur Suren, die unsere Reise professionell geplant und organisiert hat, unterhält in Elstei, gut fünfzig Kilometer von Ulaanbaatar entfernt, ein eigenes Ger-Camp in der Steppe. Zum Camp gehören fast einhundert Pferde; wer mag kann also zu einem letzten Ausritt aufbrechen. Für uns hat man eine größere Überraschung. Per Bus kommen aus Ulaanbaatar Musiker und Tänzer des mongolischen Staatstheaters in traditioneller Kleidung für ein letztes Fotoshooting und ein Konzert in der Steppe. Noch bevor der letzte Akkord verklungen ist, weiß ich, dass ich zurückkehren werde in dieses Land, in dem Zeit keine Rolle spielt.
„In der Mongolei, ist die Zeit ein Geschenk der Götter und nur dazu da, nach Herzenslust verschwendet zu werden“. (Fritz Mühlenweg)